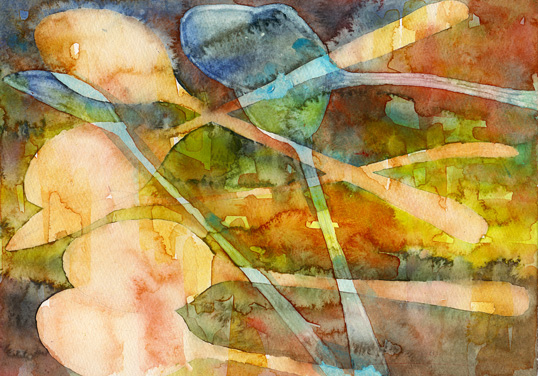ich bin heute hier, weil im letzten Jahr Radka Denemarková für ihre Übersetzung meines Romans "Atemschaukel" der Magnesia Preis verliehen wurde. Das hat mich sehr gefreut. Ich finde es sehr gut, daß mit dem Magnesia Preis auch Übersetzer ausgezeichnet werden. Denn Übersetzen ist eine eigene Kunst. Ich traue es mir nicht zu, obwohl ich perfekt Rumänisch spreche. Übersetzen heißt ja nicht Ersetzen, also für das Wort aus der fremden Sprache das bekannte Wort in der eigenen Sprache finden. Es muß das entsprechende Wort sein—das ist viel komplizierter. Man muß den Ton des Originals wieder zum Klingen bringen. Die Kunst des Übersetzens ist es, die Wörter anzuschauen, um zu sehen, wie diese die Welt sehen. Übersetzen braucht eine innere Dringlichkeit, die das ganz Andere zur größten Nähe des Originals bringt. In diese Augennähe zu kommen, ist sehr schwer. Ist große Kunst.
Ich habe erst spät Rumänisch gelernt—erst als ich 15 Jahre alt war und aus einem kleinen Dorf heraus aufs Gymnasium in die Stadt kam. Aber zur Selbstverständlichkeit wurde mir das Rumänische erst noch ein paar Jahre später, als ich bereits studiert hatte und in einer Maschinenbaufabrik arbeitete. In der Fabrik musste ich die Beschreibungen der neu importierten Maschinen, der Funktion ich nicht verstand, aus dem Deutschen ins Rumänische übersetzen, leblos Wort für Wort. Aber ich musste auch den ganzen Tag rumänisch sprechen, weil niemand deutsch konnte.
Von einer Sprache zur anderen passierten bei ein- und demselben Gegenstand jedes Mal Verwandlungen. Ich begriff: Die Muttersprache hat man fast ohne eigenes Zutun. Sie ist eine Mitgift, die unbemerkt entsteht. Von einer später dazugekommenen und anders daherkommenden Sprache wird sie beurteilt. Die Muttersprache ist momentan und bedingungslos da wie die eigene Haut. Und genauso verletzbar wie diese, wenn sie von anderen geringgeschätzt, missachtet oder gar verboten wird. Wer wie ich in Rumänien aus dem Dialektdorf mit dürftigem Schulhochdeutsch nebenher in die Landessprache der rumänischen Stadt kam, hatte es schwer. Während der ersten zwei Jahre in der Stadt war es meist leichter für mich, in unbekannter Gegend die richtige Straße zu finden, als in der Landessprache das richtige Wort. Das Rumänische verhielt sich zu mir wie mein Taschengeld. Kaum lockte mich ein Gegenstand in der Vitrine, schon reichte das Geld nicht, um ihn zu bezahlen. Viele Wörter kannte ich nicht, und die wenigen, die ich kannte, fielen mir nicht rechtzeitig ein. Aber heute weiß ich, daß dieses nach und nach, das Zögerliche, das mich unter das Niveau meines Denkens zwang, mir auch die Zeit gab, die Verwandlung der Gegenstände durch die rumänische Sprache zu bestaunen. Ich weiß, daß ich von Glück zu reden habe, weil das geschah. Welch ein anderer Blick auf die Schwalbe im Rumänischen, die rindunica, REIHENSITZCHEN heißt. Im Vogelnamen wird mitgesagt, daß die Schwalben in Reihen, eine dicht an der anderen auf dem Draht sitzen. Ich hatte es, als ich das rumänische Wort noch nicht kannte, jeden Sommer im Dorf gesehen. Es verschlug mir den Atem, daß man die Schwalbe so schön benennen kann. Es wurde immer öfter so, daß die rumänische Sprache die sinnlicheren, auf mein Empfinden besser zugeschnittenen Wörter hatte, als meine Muttersprache. Ich wollte den Spagat der Verwandlungen nicht mehr missen. Nicht im Reden und nicht im Schreiben. Ich habe in meinen Büchern noch keinen Satz auf Rumänisch geschrieben. Aber selbstverständlich schreibt das Rumänische immer mit, weil es mir in den Blick hineingewachsen ist.
Zwischen den Sprachen tun sich Bilder auf. Jeder Satz ist ein von seinen Sprechern so und nicht anders geformter Blick auf die Dinge. Jede Sprache sieht die Welt anders an und hat ihr gesamtes Vokabular durch diese andere Sicht anders gefunden—ja sogar anders eingefädelt ins Netz seiner Grammatik. In jeder Sprache sitzen andere Augen in den Wörtern.
Weshalb ich nicht übersetzen kann, liegt auch an meinem Misstrauen gegenüber der Sprache. Als meine beste Freundin sich einen Tag vor der Auswanderung von mir verabschiedete, als wir uns umarmten und dachten, wir werden uns nie wiedersehen, weil ich nicht mehr nach Rumänien darf und sie nie aus dem Land hinaus—als sich die Freundin also verabschiedete, konnten wir uns nicht voneinander losreißen. Sie ging dreimal zur Tür hinaus und kam jedesmal wieder zurück. Erst nach dem dritten Mal ging sie von mir weg, ging so lang wie die Straße war. Die Straße lief gerade und ich sah ihre helle Jacke kleiner und kleiner und seltsamer Weise mit der Entfernung greller werden. Ich weiß nicht, glänzte die Wintersonne, es war damals Februar, glänzten meine Augen in sich selbst vom Weinen oder glänzte der Stoff der Jacke—eines weiß ich jedenfalls: ich schaute der Freundin hinterher und ihr Rücken glitzerte im Weggehen wie ein Silberlöffel. So konnte ich die ganze Trennung intuitiv in ein Wort fassen, ich nannte sie Silberlöffel. Und das war es auch, was den ganzen Vorgang aufs Genaueste beschrieb. Aber was hat ein Silberlöffel mit einer Jacke zu tun? Gar nichts. Und genauso wenig mit einem Abschied. Aber im poetischen Bild brauchen sie einander.
Deshalb traue ich der Sprache nicht. Denn am besten weiß ich von mir selbst, daß sie sich, um genau zu werden, immer etwas nehmen muß, was ihr nicht gehört. Ständig frag ich mich, warum sind Sprachbilder so diebisch, weshalb raubt sich der gültigste Vergleich Eigenschaften, die ihm nicht zustehen. Erst die erfundene Überraschung bringt die Nähe zum Wirklichen zustande. Erst wenn eine Wahrnehmung die andere ausraubt, ein Gegenstand das Material des anderen an sich reißt und benutzt—erst wenn das, was sich im Wirklichen ausschließt, im Satz plausibel geworden ist, kann sich der Satz vor dem Wirklichen behaupten.
Ich bin froh, wenn mir das gelingt.